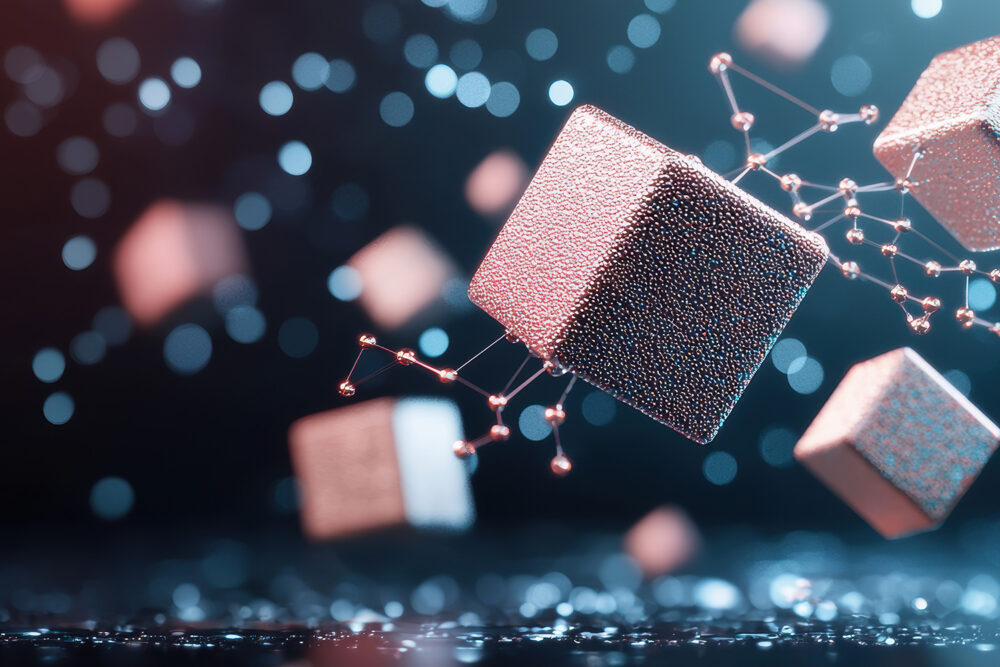Der Turing-Test ist mehr als nur ein Experiment – er ist ein philosophisches Konzept, das das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine hinterfragt. Obwohl er als Werkzeug zur Messung künstlicher Intelligenz heute nur noch begrenzt eingesetzt wird, bleibt seine Grundidee hochrelevant. Sie erinnert uns daran, dass Intelligenz nicht nur in Algorithmen und Prozessoren steckt, sondern auch in unserer Fähigkeit, Kommunikation zu interpretieren und Bedeutung zu erkennen.